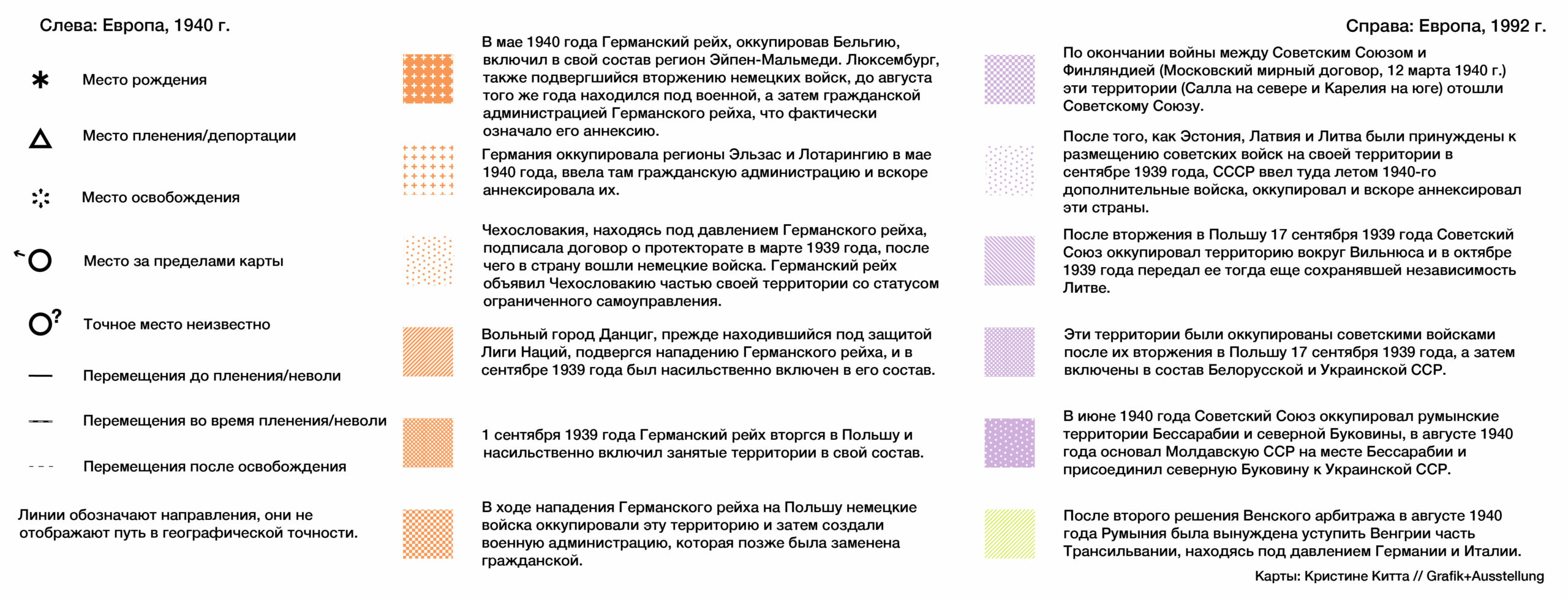"Wir wussten nicht, wie das alles enden würde"
Alexandra Wajtkus in Hamburg. Datum und Fotograf unbekannt. Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme
Alexandra Paramonowna Wajtkus (geb. 1926)* war eine sowjetische Zwangsarbeiterin.
Sie wurde im Dorf Bogorodskoje (Gebiet Belgorod, Russland) geboren und war das einzige Kind ihrer Eltern. Ihr Vater arbeitete als Schuhmacher, ihre Mutter war Kolchosarbeiterin. Die Schulbildung der Kinder aus dem Dorf war in der Regel nach der Grundschule vorbei, da die nächste weiterführende Schule sechs Kilometer entfernt war. Alexandra war eine der wenigen, die sich von der Entfernung nicht einschüchtern ließen und ihre Ausbildung mit sehr guten Noten fortsetzte.
Die deutsche Besatzung ihres Dorfes begann im Juli 1942. Laut Alexandras Erinnerungen wurde im November eine Liste mit allen jungen Dorfbewohner:innen zwischen 20–26 Jahren erstellt, die später zum Sammelpunkt und dann zur Zwangsarbeit nach Deutschland gebracht wurden. Aus ungeklärten Gründen fiel auch die 16-jährige Alexandra in diese Welle der Zwangsarbeitsmobilisierung.
In Deutschland kam sie als Haushaltshilfe und Kindermädchen zur Familie eines hochrangigen Militärs in Hamburg. Das Mädchen staunte über den Wohlstand im Haus, wo es eine Wasserleitung und einen Staubsauger gab. Zu ihren Aufgaben gehörte es, sich um die Kinder und das Haus zu kümmern. Die Deutschen, die sie „einstellten“, behandelten sie wohlwollend, da das Mädchen ihre Aufgaben erfüllte. Sie erinnert sich an folgende Episode:
„Als alle [Gäste] am Tisch saßen, nahm sie [die Gastgeberin] mich an der Hand, führte mich hinein, setzte mich in die Mitte und sagte: ‚Hier ist ein russisches Mädchen, so klug, so aufmerksam.‘ [Die Gäste] lächelten und sagten: ‚Russisch, also nicht schlecht, nicht schlampig, nicht…‘ – Ich werde diese Worte nicht wiederholen, damit sie nicht im Interview auftauchen. Dies wurde gesagt. ‚Nun, ich bin anderer Meinung, also dieses Mädchen ist sehr gut‘, antwortete die Hausherrin.“

Die „Hausherrin“ von Alexandra, Emma Heiser (zweite von links), mit ihrer Gehilfin Elsa (erste von rechts) und den Kindern. Kirchberg (Tirol, Österreich). Juli-August 1943. Fotograg unbekannt. Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme.
Trotz der relativ guten Bedingungen der Zwangsarbeit in der Familie spürte Alexandra die hohe Arbeitsbelastung. Auch die Trennung von der Heimat war für sie schwer zu ertragen. Noch im hohen Alter reflektiert die Befragte, wie sie durch die Verschleppung nach Deutschland ihrer Kindheit beraubt wurde:
"Und das sind die Gefühle, die ich hatte, als ich in eine [deutsche] Familie kam, das Einzige, was ich fühlte war schreckliches Heimweh. Als ich zum ersten Mal Schneeflocken sah... Ich hatte solche Tränen. (...) Sie kleiden mich dort [in Hamburg] schön ein. Und sie bringen mich zum Friseur und geben mir gutes Essen. Aber ich sehne mich nach der Wiese. Ich will barfuß laufen. Ich will mit den Mädchen Lapta spielen, verstehen Sie? Ich dagegen musste arbeiten. Heutzutage kann man kein einziges [Mädchen] zu irgendetwas bewegen, nicht einmal unsere Kinder. Sie wollen nur in die Hochschule gehen, tanzen und ausgehen. Wir hatten das aber nicht."
In Hamburg überlebte Alexandra einen Bombenangriff, bei dem die Villa ihrer „Hausherren“ beschädigt wurde. Das Feuer brach nachts aus, Alexandra entkam wie durch ein Wunder und rettete das einzige Kind im Haus. Stundenlang mussten sie in den Trümmern ausharren, bis die Schreie des Babys die Rettungskräfte auf den Plan riefen. Weder das Baby noch Alexandra wurden verletzt. Die Familie Heiser und Alexandra zogen mehrere Monate lang von Dorf zu Dorf, bis sie nach Hamburg in ein neues Haus zurückkehrten.

Alexandra Wajtkus mit Kindern der Familie Heiser in Kirchberg (Tirol, Österreich), wohin sie nach den Bombenangriffen auf Hamburg vorübergehend gezogen waren. Juli-August 1943. Fotograf unbekannt. Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme.
In ihrer Freizeit durfte das Mädchen spazieren gehen. Bald lernte sie in einem Stadtpark ihren zukünftigen Ehemann kennen, einen Zwangsarbeiter aus Leningrad (heute St. Petersburg, Russland). Zwischen ihnen entwickelte sich eine romantische Beziehung, an die sich Alexandra folgendermaßen erinnert:
„Was für Angst?! Selbst wenn Bomben vom Himmel gefallen wären, hätten wir uns getroffen! (…) Und ohne diese schreckliche Liebe hätte es wahrscheinlich nichts gegeben. Denn [wir] genossen jeden Tag. Morgen wirst du umgebracht, und kannst nie wieder küssen. (…) Es waren ganze Liebesromane. Nicht nur für mich, für alle. Das war doch unsere Jugend. Und da uns alles verboten war, erschien uns jede solche Begegnung wie ein großes Licht im Fenster, als ob es etwas Unglaubliches wäre, so.“

Alexandra Wajtkus vor dem Haus der Hamburger Familie, bei der sie Zwangsarbeit leistete. Datum und Fotograf unbekannt. Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme.
„Das bin ich in der Hochauer Allee [Hochallee in Hamburg – Anm. d. Verf.], auf dem Balkon: Ich hatte den Pullover der Hausherrin an, die Hose der Hausherrin, ja. (…) Das interessierte uns. Ich habe noch nie gesehen, dass junge Frauen Hosen trugen. Ich zog die Hose der Hausherrin an und hängte dann alles in den Schrank. (…) Elsa, die Putzkraft… eher das Dienstmädchen machte Fotos. Sie und ich nutzten auch den Fotoapparat der Hausherrin.“
Eines Tages rannte Alexandra im Morgenmantel und in Pantoffeln aus dem Haus, um sich mit ihrem Freund zu treffen. Dabei ließ sie das Kind der „Hausherren“ allein in der Wohnung zurück, und wurde sofort von der Polizei geschnappt. Das Verlassen des Arbeitsplatzes wurde als Fluchtversuch gewertet, wofür die junge Frau ins Konzentrationslager und Gefängnis Fuhlsbüttel (Hamburg) geschickt wurde. Das Gefängnis setzte Häftlinge zur Arbeit in einer nahegelegenen Fischfabrik ein.
Nach einigen Monaten im Gefängnis wechselte Alexandra zwei weitere „Arbeitsorte“, an die sie sich nicht mehr genau erinnert. Auf jeden Fall, so sagt sie, behandelten alle Deutschen sie freundlich, wendeten keine Gewalt an und aßen mit ihr an einem Tisch, was offiziell verboten war. In einer Familie empfahl ihr die „Hausherrin“ sogar, ihren OST-Aufnäher abzunehmen, wenn sie das Haus verließ, was einen eklatanten Verstoß gegen die Regeln darstellte. Alexandra war sich ihrer relativ guten Bedingungen als Zwangsarbeiterin bewusst und versuchte Verschleppten zu helfen, die weniger Glück hatten. So behauptet sie beispielsweise, Lebensmittel in Lager für Zwangsarbeiter:innen aus der Sowjetunion gebracht zu haben.
Wie fühlten sich Zwangsarbeiter:innen, die in einem fremden Land für die Nationalsozialisten arbeiteten? Alexandra erinnert sich:
Das Konzentrationslager und Gefängnis Fuhlsbüttel dienten seit 1933 zur Verfolgung politischer Gegner der Nationalsozialisten. Zu den Hauptgruppen der Gefangenen gehörten vor dem Zweiten Weltkrieg Kommunisten und Sozialdemokraten, Juden, Zeugen Jehovas, Personen, die mit dem Regime nicht einverstanden waren und von Nationalsozialisten als „asozial“ eingestufte Menschen. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden auch Widerstandskämpfer und ausländische Zwangsarbeiter nach Fuhlsbüttel geschickt, wenn sie gegen diskriminierende Gesetze verstoßen hatten. Von Oktober 1944 bis April 1945 befand sich in einem Gefängnisgebäude auch eine Außenstelle des Konzentrationslagers Neuengamme. In allen Einrichtungen in Fuhlsbüttel starben mehr als 500 Menschen an Folter und Misshandlungen. Ein Teil der Gebäude fungiert immer noch als Männergefängnis. Im ehemaligen Eingangsgebäude befindet sich eine Gedenkstätte mit einer Ausstellung über den nationalsozialistischen Terror.
"„Am Anfang war der Eindruck schrecklich, unsicher. Die Angst war schrecklich. Später stumpfte das Angstgefühl ab, verstehen Sie? Und dann... naja... ähm... dann haben wir schlicht gelebt, wir haben gelebt, gelebt, gelebt. Ich gewöhnte mich an die Familie. Selbst wenn mir jemand gesagt hätte, wir würden hier mit einander sprechen oder wir kommen nach Russland [gemeint ist die Rückkehr in die Sowjetunion nach dem Krieg - Anm. d. Verf.], haben wir nicht damit gerechnet. Niemand hat das erwartet. Wir wussten nicht, wie das alles enden würde.“"

Alexandra Wajtkus mit Kindern der Familie Heiser in Kirchberg (Tirol, Österreich), wohin sie nach den Bombenangriffen auf Hamburg vorübergehend gezogen waren. Juli-August 1943. Fotograf unbekannt. Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme.
Die Befreiung Hamburgs durch britische Truppen bemerkte die junge Frau nicht. Als sie eines Tages Anfang Mai aufwachte, fand sie die Bierhalle und die SS-Garagen völlig leer vor und verstand nicht, was geschehen war. Nach einiger Zeit holte ihr zukünftiger Ehemann sie ab und brachte sie zur Sammelstelle im ehemaligen Arbeitslager Kampnagel. Schon damals kursierten unter den Zwangsarbeiter:innen Gerüchte, dass sie in der Heimat wegen „Arbeit für den Feind“ bestraft würden.
Das Arbeitslager „Kampnagel“ entstand um eine Fabrik für Schiffs- und Hafenkräne. Während des Zweiten Weltkriegs wurde diese zu einer Rüstungsfabrik umgewandelt. Bei der Fabrik wurden sechs Lager für rund 500 ausländische Zwangsarbeiter:innen eingerichtet, darunter auch aus der Sowjetunion. Nach Kriegsende arbeitete die Fabrik weiter als weltbekannter Kranhersteller. Das Werk wurde 1981 geschlossen. Bald darauf entstand das gleichnamige Kulturzentrum und Theater, das bis heute existiert. Im Rahmen des Projekts „Zwangsarbeit und Widerstand“ untersucht das Kulturzentrum die nationalsozialistische Vergangenheit des Ortes und stellt in regelmäßigen öffentlichen Vorträgen Forschungsergebnisse vor.
Später kamen Vertreter der sowjetischen Besatzungsverwaltung in die Sammelstelle und brachten alle sowjetischen Zwangsarbeiter:innen in den Nordosten Deutschlands. In der sowjetischen Besatzungszone wurden sie erneut als Zwangsarbeiter:innen ausgebeutet, nun aber nicht mehr von Deutschen, sondern von sowjetischen Kommandanturen und Militäreinheiten. Alexandra und ihre Begleiterinnen mussten Sortierarbeiten in Bekleidungskammern verrichten. Im Interview berichtet sie beiläufig von häufigen Fällen sexualisierter Gewalt seitens der Rotarmisten gegen heimkehrende Frauen.
Nach einigen Monaten gelang es Alexandra über den Kontrollpunkt Waukawysk (Belarus) in ihr Heimatdorf Bogorodskoje zurückzukehren. Neben Verhören an der Grenze wurde sie in ihrem Heimatdorf vom örtlichen NKWD überprüft, was jedoch glimpflich ausging: Der Fall der Befragten erregte keinen Verdacht der Kollaboration mit den Nationalsozialisten.
Das Schicksal von Alexandras Ehemann nach der Befreiung war diametral entgegengesetzt. Aus ihren Memoiren geht nicht eindeutig hervor, was mit Ewgenij Wajtkus in den Jahren 1945–1946 geschah. Aber sie behauptet, dass er in ein Lager in Orsk, in Sibirien (Russland) gebracht wurde, wo er lange Zeit verhört wurde. Zu dieser Zeit gab es in Orsk noch keine Kontroll- und Filtrationslager. Deshalb können wir davon ausgehen, dass Ewgenij in ein Arbeitsbataillon geschickt wurde und in einem Industriebetrieb eingesetzt wurde, den er nicht verlassen durfte. Dort durchlief er eine wiederholte politische Überprüfung durch den Sicherheitsdienst. Dort bemühte er sich darum, so Alexandra, nach Leningrad zurückkehren zu dürfen, was allen Repatriierten verwehrt wurde. Dank einer Petition an Andrej Schdanow, den ehemaligen Chef der kommunistischen Partei in Leningrad, konnte er zu seiner Mutter und seinen Schwestern zurückkehren, die die Blockade Leningrads überlebt hatten. 1947 holte er seine spätere Ehefrau Alexandra aus dem Dorf nach Leningrad.
Nach dem Umzug nach Leningrad mit ihrem Mann, versuchte Alexandra Arbeit zu finden, wurde aber aufgrund ihres Personalfragebogens abgelehnt, vor allem, weil sie während des Krieges in Deutschland gewesen war. Später fand Alexandra eine Stelle als Verkäuferin, dann als Konditorin, und Jahre später wurde sie Tourismusausbilderin. Ihr Mann Ewgenij, ebenfalls ein ehemaliger Zwangsarbeiter, arbeitete in der Lesgaft-Sporthochschule. Das Paar lebte 43 Jahre zusammen, hatte mehrere Kinder, später kamen Enkelkinder hinzu.

Alexandra Wajtkus im Gespräch mit dem „Freundeskreis der KZ-Gedenkstätte Neuengamme”, Hamburg, 2002, Foto von Katharina Hertz-Eichenrode, Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme.
Es ist nicht bekannt, ob die Befragte eine Entschädigung für die Zwangsarbeit in Deutschland oder Leistungen als Kriegsteilnehmerin in Russland erhalten hat. Im Jahr 2002 nahm Alexandra auf Einladung des Freundeskreises der Gedenkstätte Neuengamme und der Bürgerschaft an einer Gedenkfahrt nach Hamburg teil, wo sie dem „Freundeskreis“ in einem mehrstündigen Gespräch von ihren Erfahrungen berichtete.
Die Stigmatisierung der Repatriierten und die Tabuisierung ihrer Erfahrungen in der Sowjetunion führten dazu, dass die ehemaligen Zwangsarbeiter:innen sich nur selten als „echte“ Opfer des Nationalsozialismus sahen. Dies traf insbesondere auf diejenigen zu, die auf Bauernhöfen oder in Privathaushalten eingesetzt waren. Das war auch bei Alexandra der Fall:
„Warum wurde ich denn als Häftling bezeichnet [gemeint ist der russische Status ‚ehemaliger jugendlicher Häftling von Konzentrationslagern, Ghettos und anderen von Faschisten während des Zweiten Weltkriegs errichteten Orten der Zwangshaft‘]? Ich bin kein Häftling, verstehen Sie? Jetzt verstehe ich, dass ich aus moralischen Gründen ein Häftling bin. Aber am Anfang war ich irgendwie auf einer undefinierbaren Höhe im Vergleich zu anderen, die Entbehrungen ertragen mussten [gemeint ist, dass Alexandras Zwangsarbeitsbedingungen viel besser waren als die der anderen Zwangsarbeiter:innen]. Ich kann mir das bis heute nicht vorstellen. Wie konnte das sein? Ich hatte so viel Glück und die hatten so viel Pech“.
* Das Todesdatum von Alexandra Waitkus ist unbekannt.
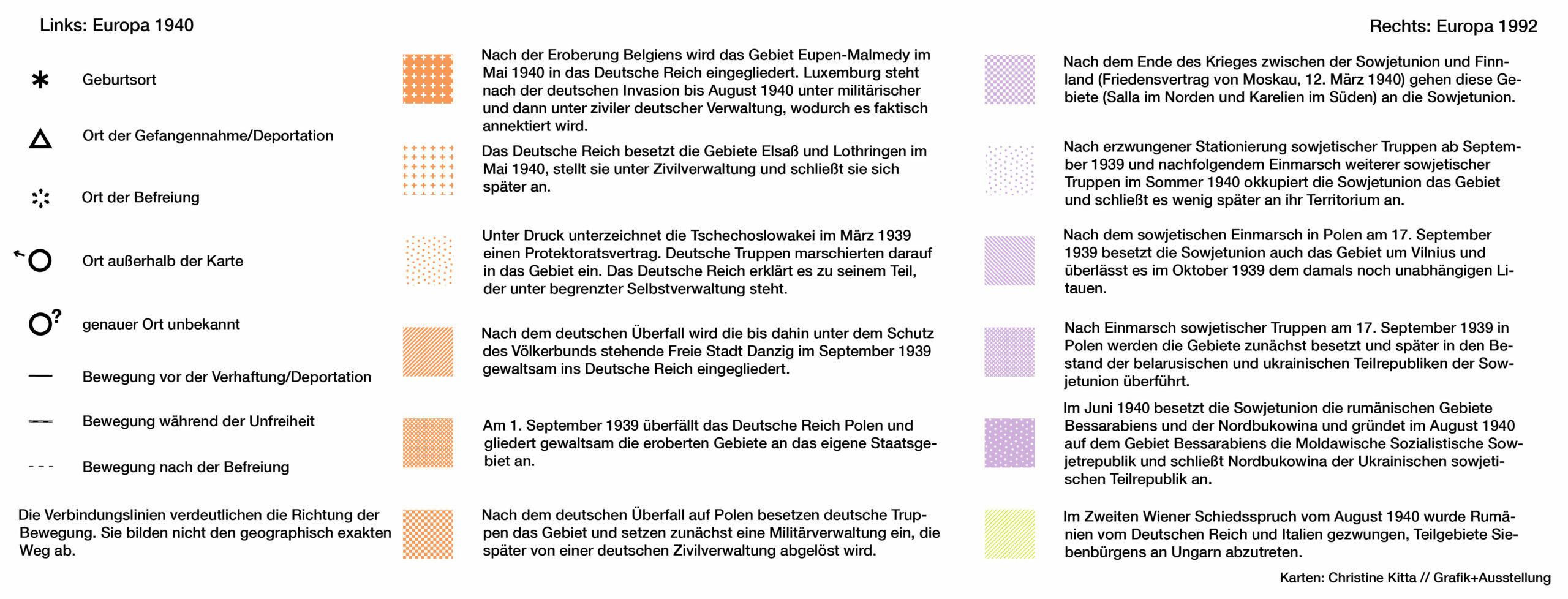
Verfasserin: Evelina Rudenko
Quelle:
Interview mit Alexandra Wajtkus aus dem Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme.